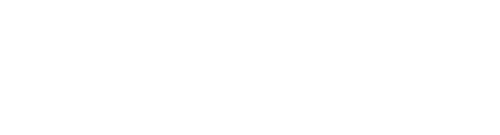Bereits letztes Jahr gelangte ein unbestätigter Referentenentwurf eines „Verbandssanktionengesetzes“ (VerSanG) an die Öffentlichkeit (wir berichteten). Der Entwurf sah eine strengere Sanktionierung von Unternehmen vor als bisher. Nachdem das Gesetzesvorhaben zwischenzeitlich am Widerstand des Koalitionspartners CDU zu scheitern drohte, hat das Bundesjustizministerium nun einen offiziellen, überarbeiteten Entwurf herausgegeben. Die Änderungen zum ursprünglichen Entwurf sind überschaubar.
Bereits letztes Jahr gelangte ein unbestätigter Referentenentwurf eines „Verbandssanktionengesetzes“ (VerSanG) an die Öffentlichkeit (wir berichteten). Der Entwurf sah eine strengere Sanktionierung von Unternehmen vor als bisher. Nachdem das Gesetzesvorhaben zwischenzeitlich am Widerstand des Koalitionspartners CDU zu scheitern drohte, hat das Bundesjustizministerium nun einen offiziellen, überarbeiteten Entwurf herausgegeben. Die Änderungen zum ursprünglichen Entwurf sind überschaubar.
Wer fällt unter das VerSanG?
Der Gesetzesentwurf regelt die Sanktionierung von „Verbänden“. Unter einem Verband sind laut Gesetzesentwurf juristische Personen des öffentlichen oder privaten Rechts, nicht rechtsfähige Vereine und rechtsfähige Personengesellschaften zu verstehen. Unter den Anwendungsbereich des alten Entwurfs fielen auch nicht wirtschaftlich tätige Organisationen. Im neuen Entwurf findet das Verbandssanktionengesetz bei Verbänden, deren Zweck nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist, jedoch keine Anwendung. Hier bleibt es bei einer Ahndung nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz.
Wann liegt eine wirtschaftliche Zweckverfolgung vor?
Ob ein wirtschaftlicher Zweck verfolgt wird, richtet sich nach den zu §§ 21, 22 des BGB entwickelten Grundsätzen für die Unterscheidung zwischen ideellen und wirtschaftlichen Vereinen. Dabei kommt es darauf an, ob der Hauptzweck des Vereins auf einen „wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb“ gerichtet ist. Eine wirtschaftliche Betätigung liegt dann vor, wenn der Verein am Markt gegenüber Dritten unternehmerisch tätig wird, für seine Mitglieder unternehmerische Teilfunktionen wahrnimmt oder allein gegenüber seinen Mitgliedern unternehmerisch auftritt.
Auch ideelle Vereine können in geringem Umfang unternehmerisch tätig sein, wenn die wirtschaftliche Tätigkeit dem nicht wirtschaftlichen Zweck funktional untergeordnet ist (sog. „Nebenzweckprivileg“). Die Entwurfsbegründung verweist weiterhin auf den sog. KiTa-Beschluss des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 16.05.2017 (AZ: II ZB 7/16), wonach die Anerkennung eines Vereins als gemeinnützig Indizwirkung dafür habe, dass er nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist.
Problematische Abgrenzung im Einzelfall
Die Beschränkung des Verbandssanktionengesetzes auf wirtschaftlich tätige Verbände ist lobenswert, wird in der Praxis jedoch zu erheblichen Abgrenzungsschwierigkeiten führen. Unklar ist zum Beispiel, ob Berufsverbände in den Anwendungsbereich fallen. Diese sind keine wirtschaftlichen Vereine, verfolgen aber gleichsam wirtschaftliche Interessen ihrer Mitglieder. In der Folge wird es zur Rechtsunsicherheit bei den Verfolgungsbehörden (Besteht Verfolgungszwang oder nicht?) und bei den betroffenen Verbänden (Mit welchen Strafen ist zu rechnen?) kommen. Eine weitere Klarstellung des Gesetzgebers wäre deshalb wünschenswert.
Geldbußen durch gute Compliance verhindern
Da es auch für Organisationen, die nicht dem Geltungsbereich des neuen Gesetzes unterfallen, zu einer Unternehmensgeldbuße nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz kommen kann, sollten Rechtsverstöße von Mitarbeitern im Vorfeld durch umfangreiche Compliancemaßnahmen verhindert werden. Nach dem Verbandssanktionengesetz hat das Gericht zudem Compliancemaßnahmen im Vorfeld und im Nachgang der Tat sanktionsmindernd zu berücksichtigen. Bei kleineren Unternehmen reichen dazu auch einige wenige Maßnahmen, wie die Errichtung von Checklisten, Standardverfahren und Verhaltensrichtlinien aus.
Wir unterstützen Sie gerne
Interne Ermittlungen (sog. „internal investigations“) sind unabhängig vom Verbandssanktionengesetz auch für gemeinnützige Organisationen sinnvoll, um eine Haftung der Vorstandsmitglieder/Geschäftsführung zu reduzieren sowie einen Reputationsschaden zu verhindern. Straftaten können sogar auch den Gemeinnützigkeitsstatus gefährden.
Unsere Experten beraten Sie gerne zum Verbandssanktionengesetz und errichten passende Compliancestrukturen für Ihr Unternehmen bzw. Ihren Verein. Solche Compliancemaßnahmen wirken sich in der Regel strafmildernd aus.
Weiterlesen:
Verbandssanktionengesetz kommt: Schärfere Ahndung von Unternehmenskriminalität
Was sind die Vorteile einer guten Compliance?
Tags: Verbandssanktionengesetz